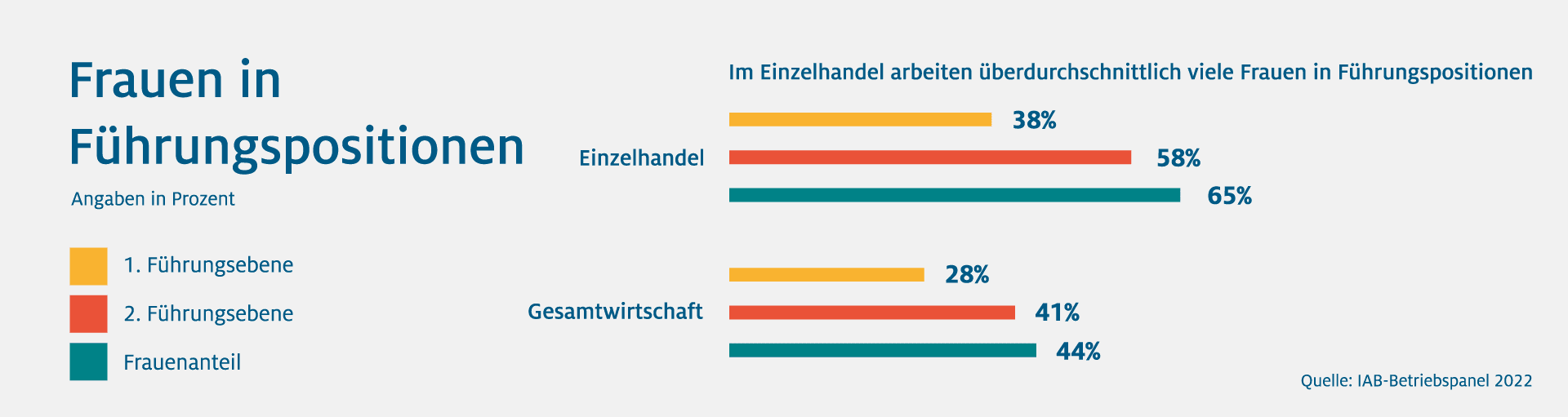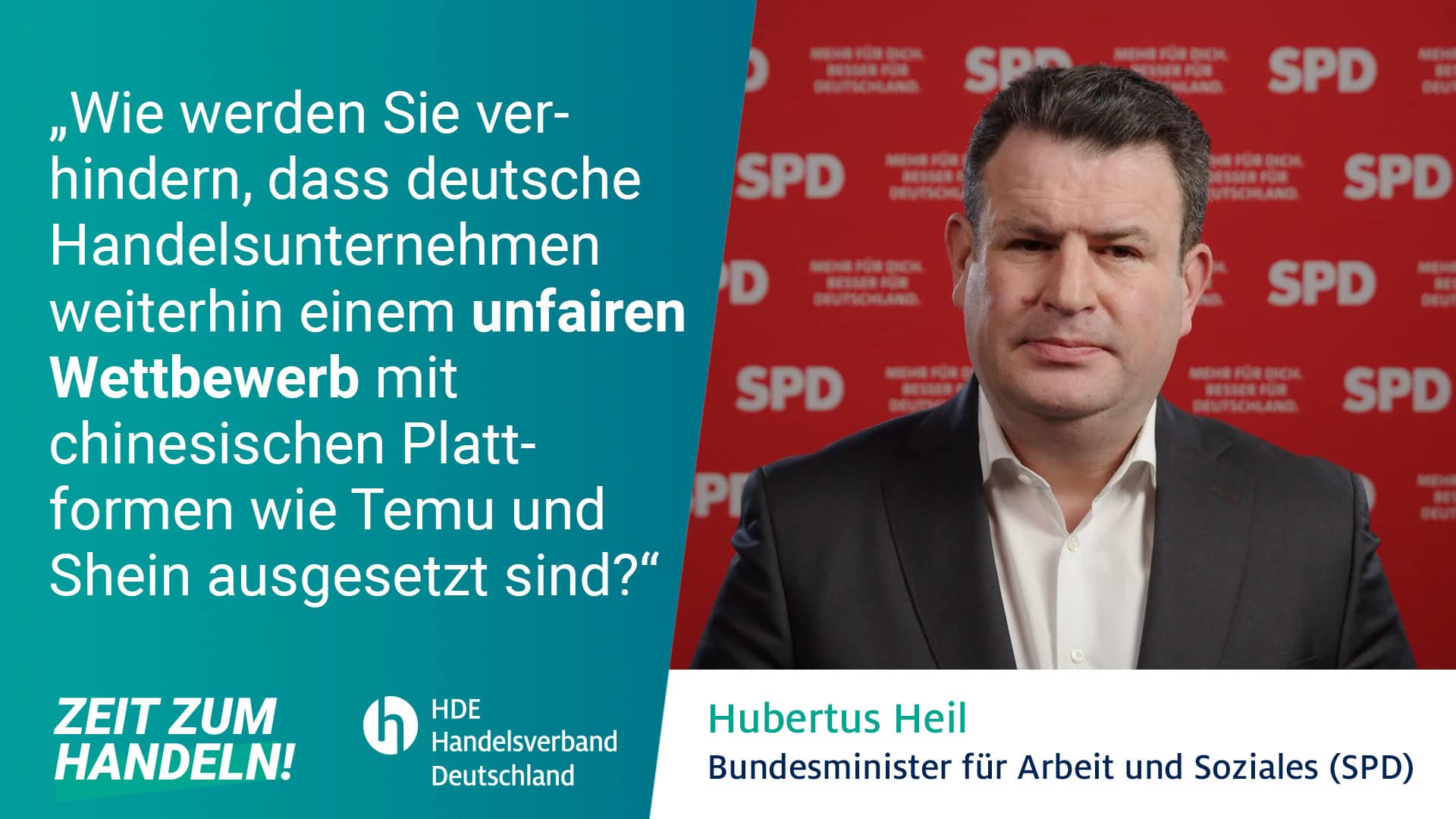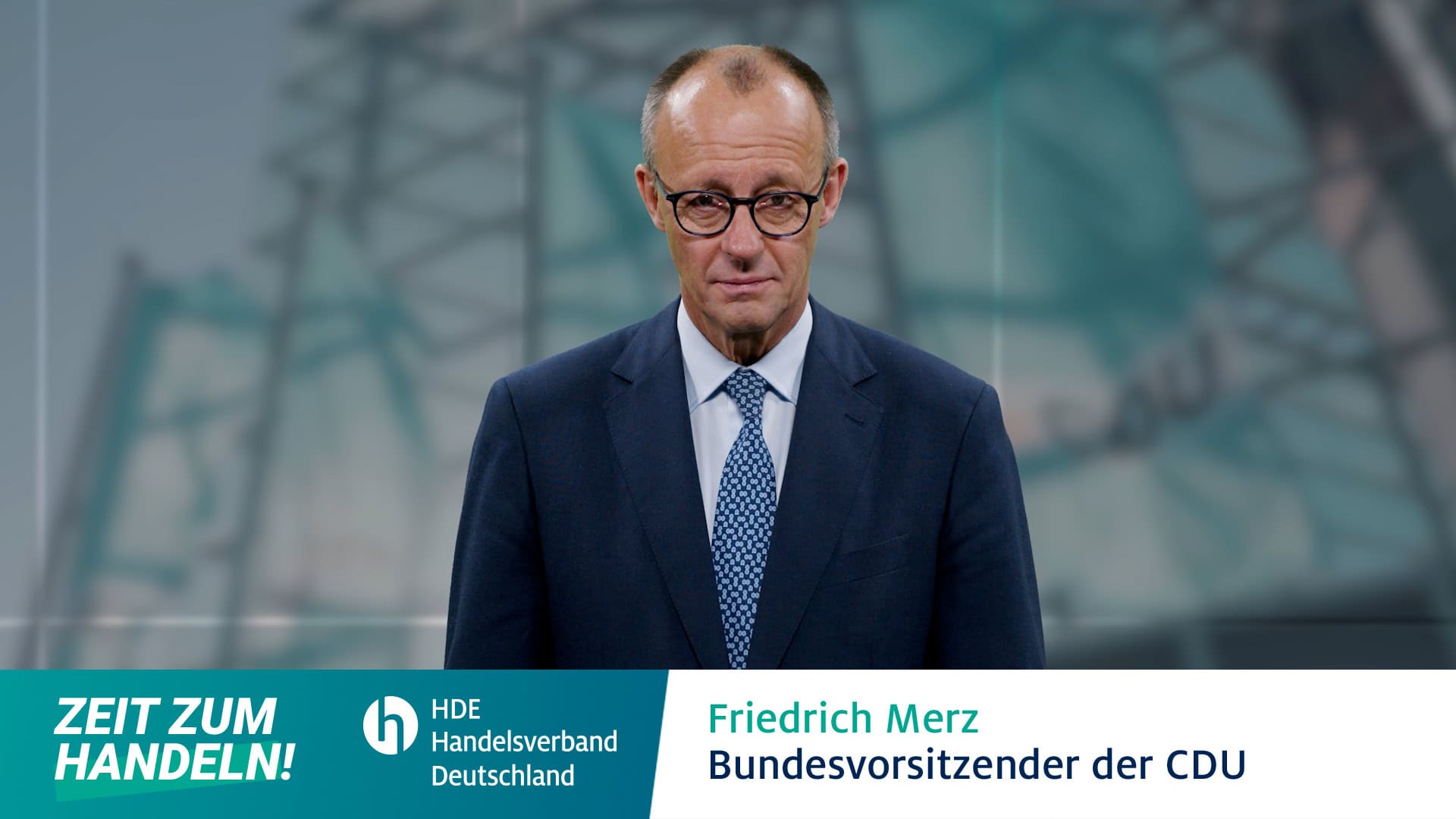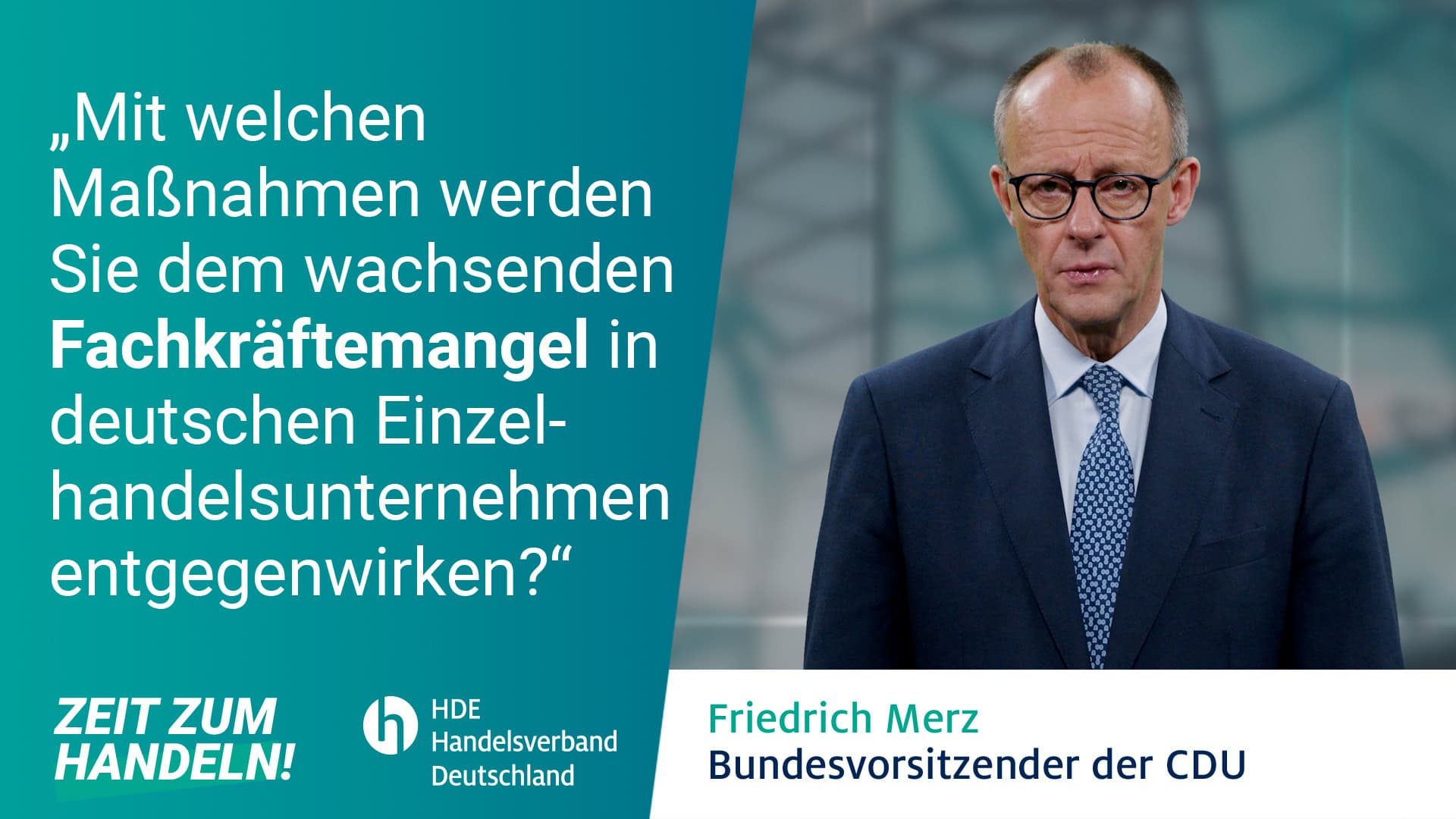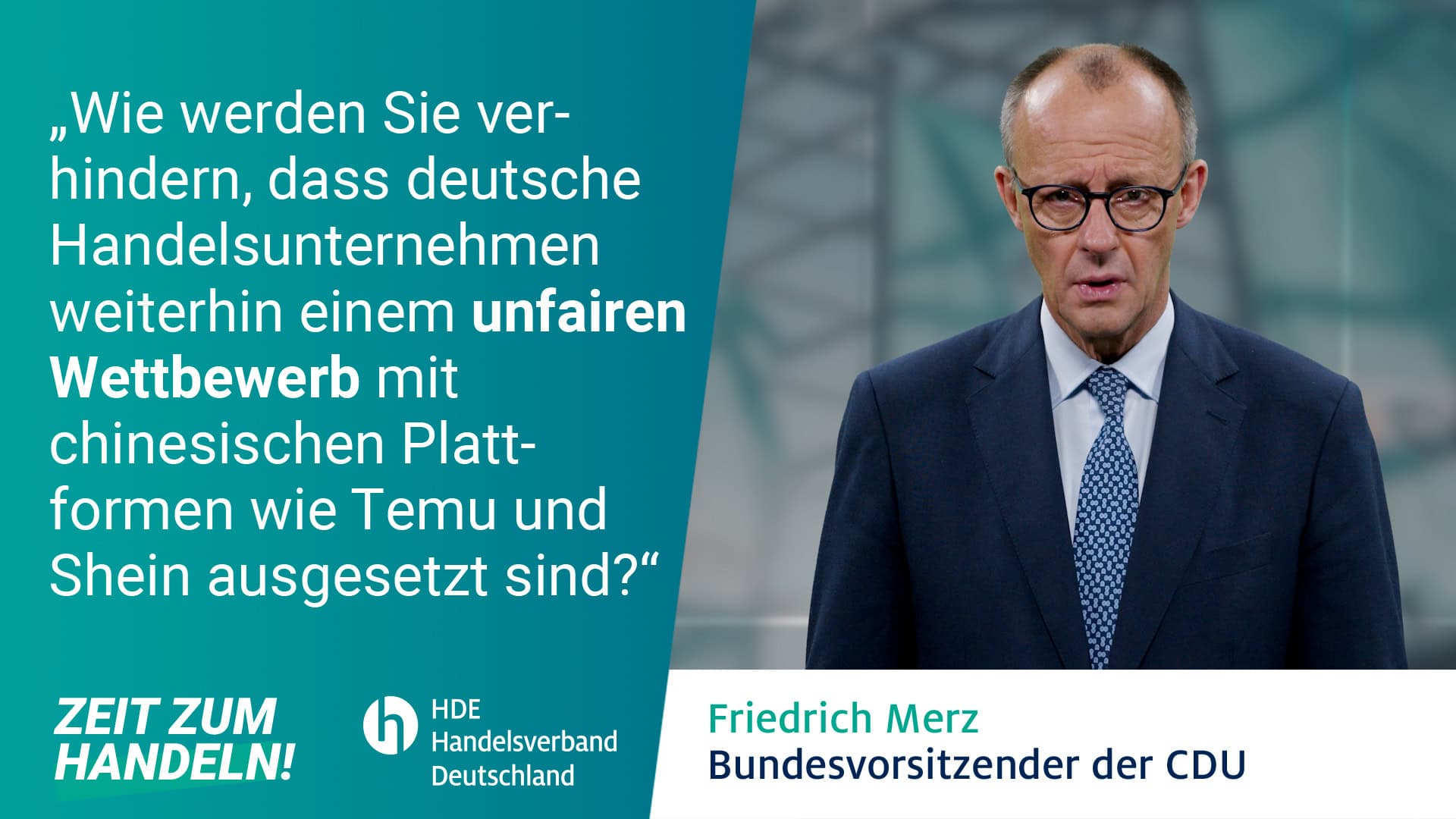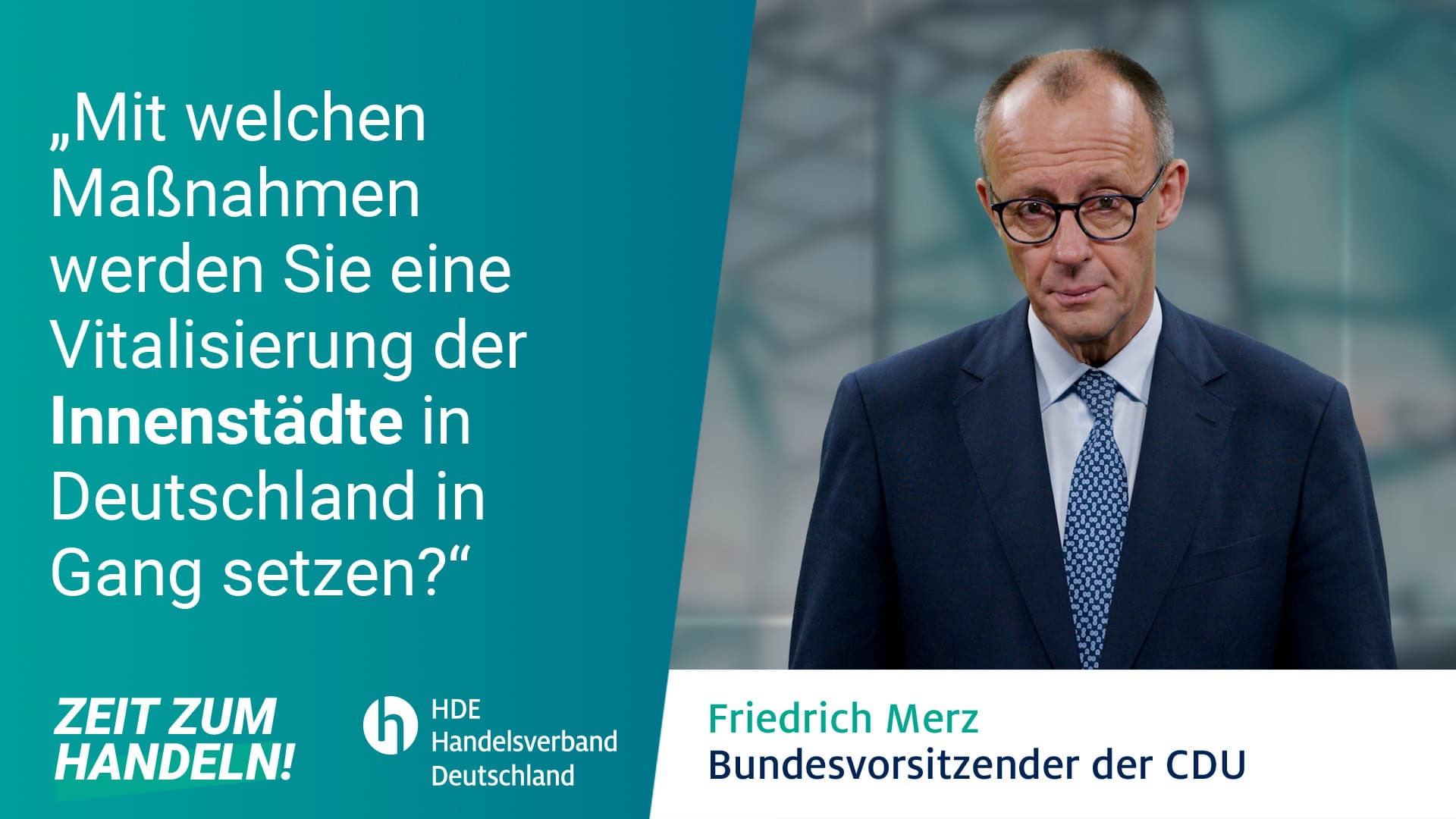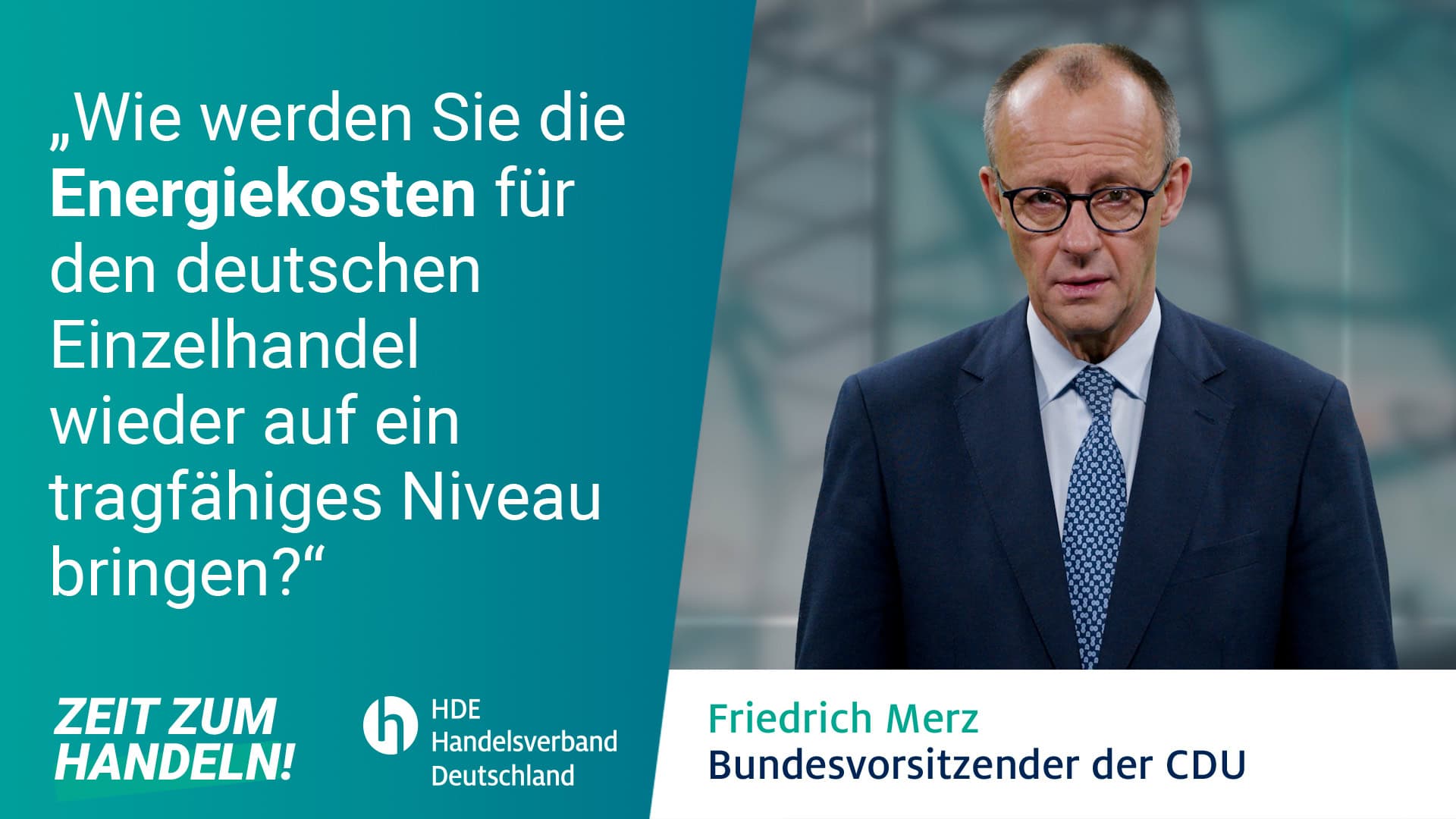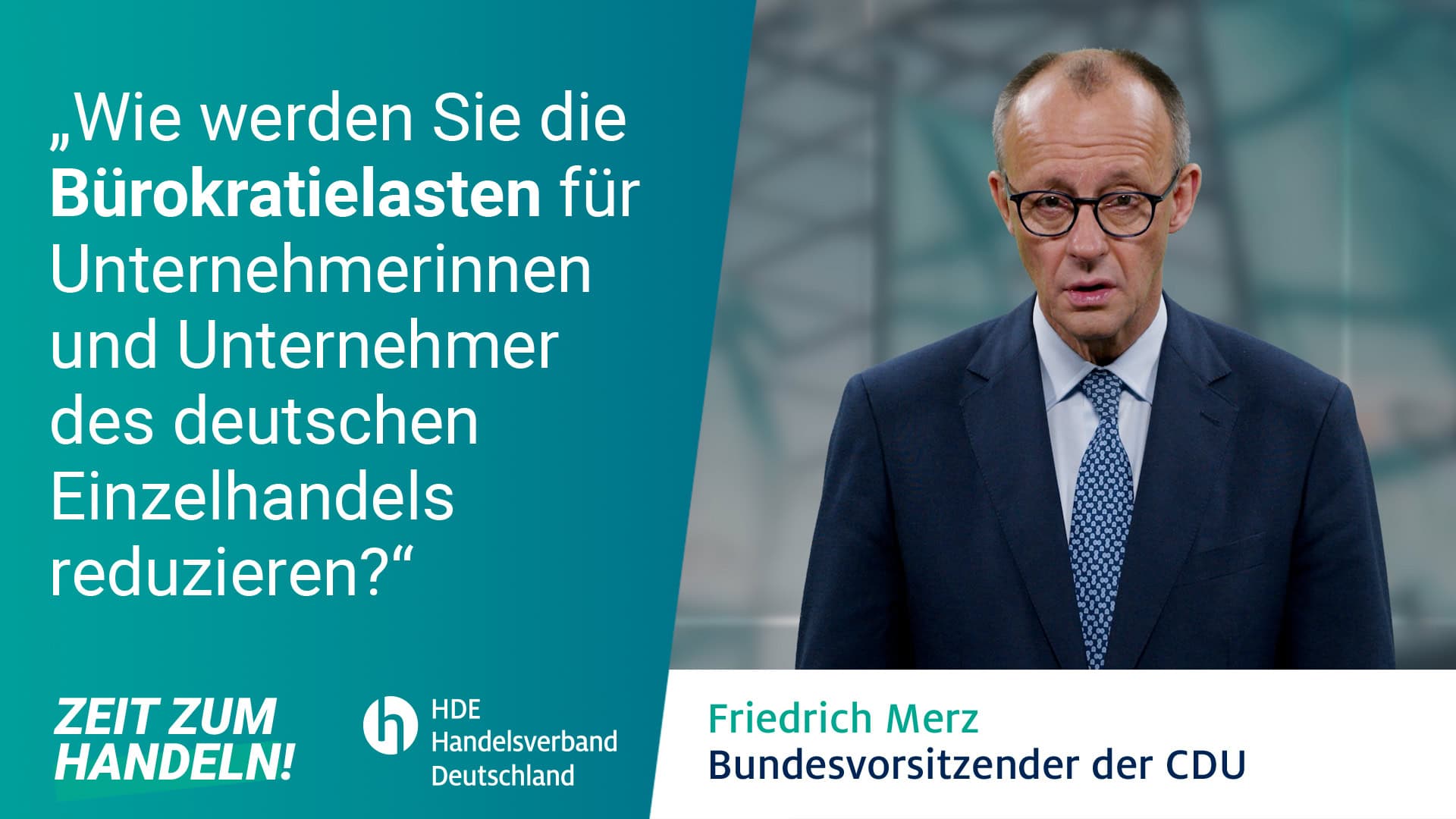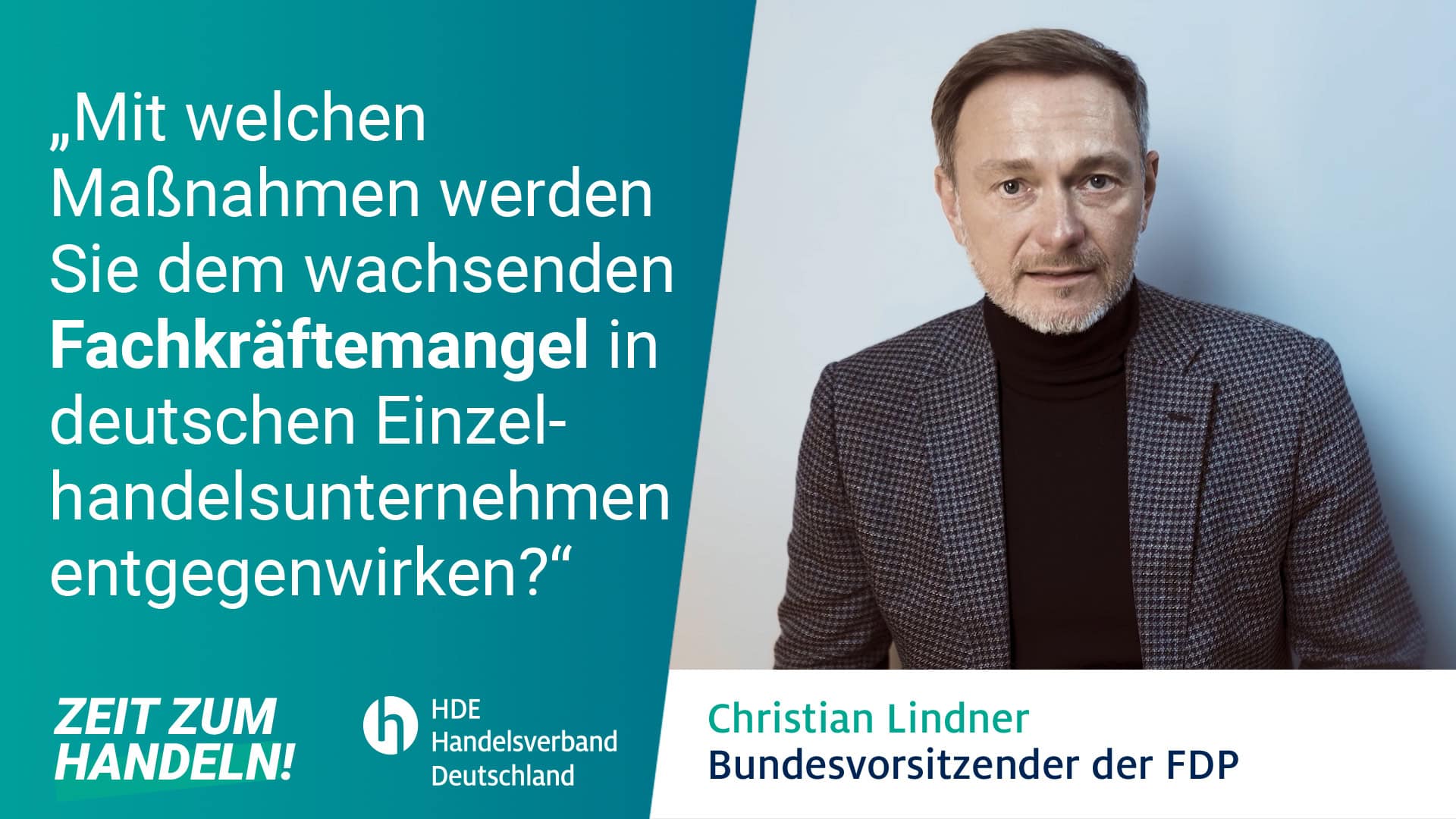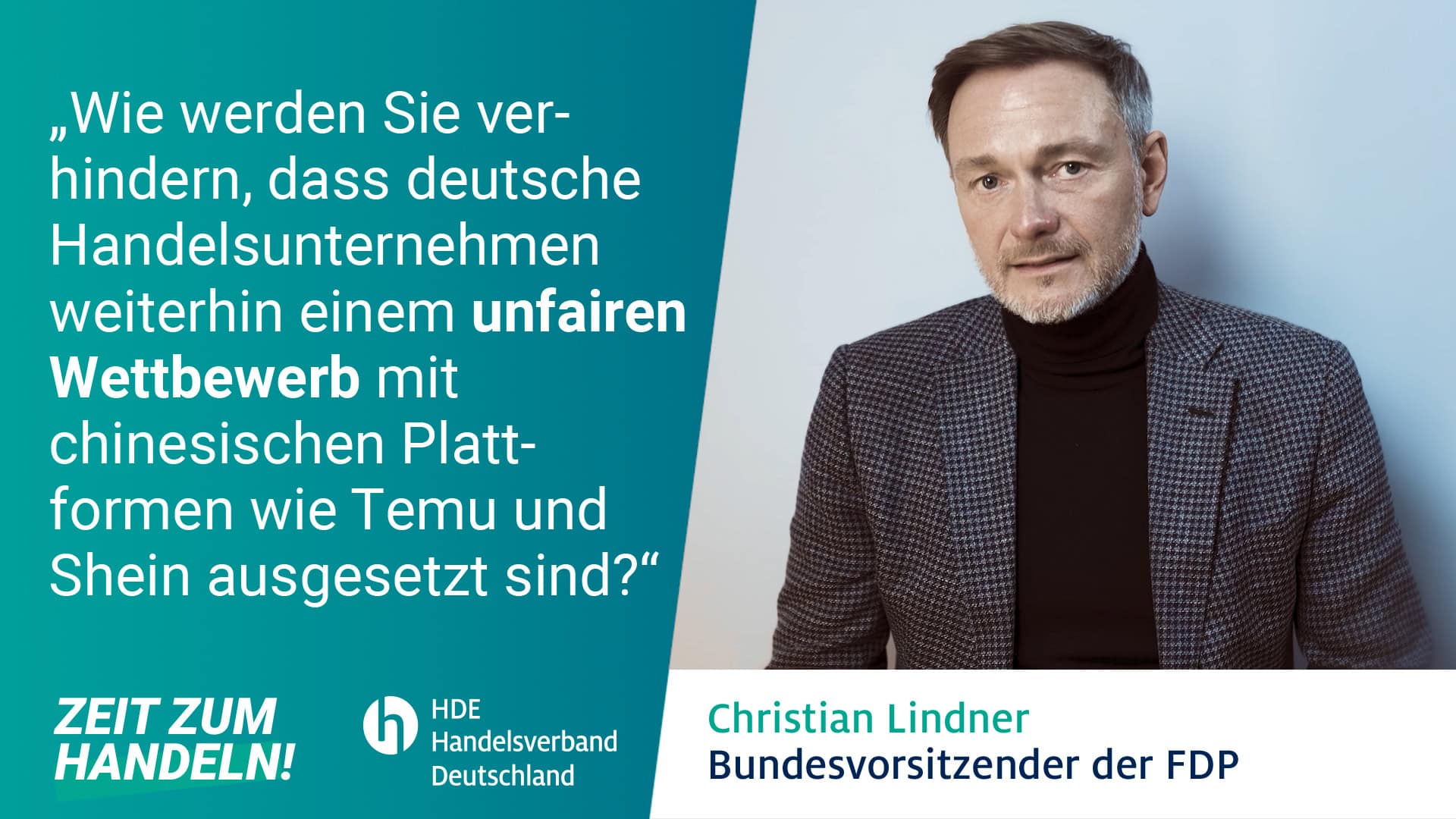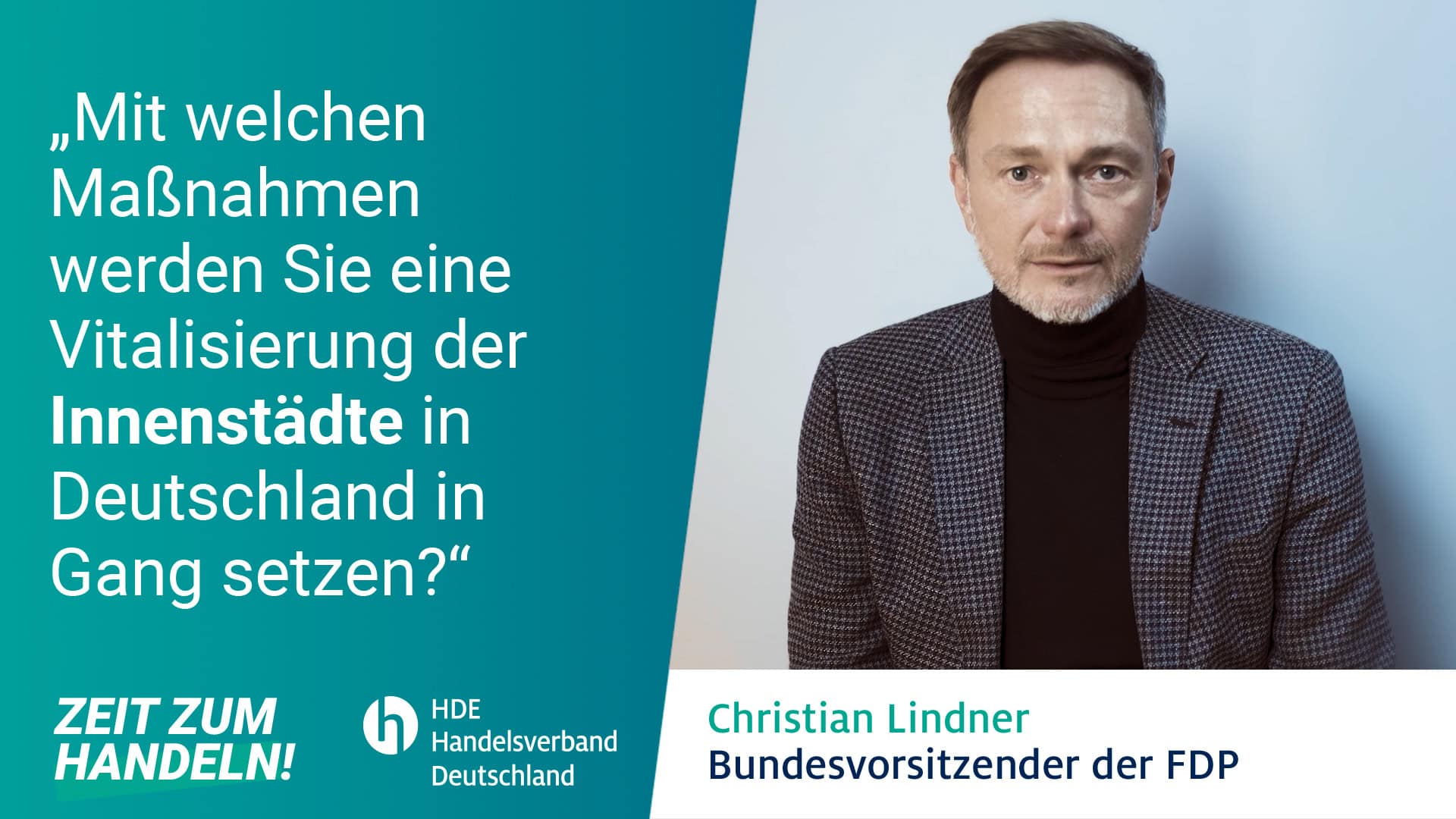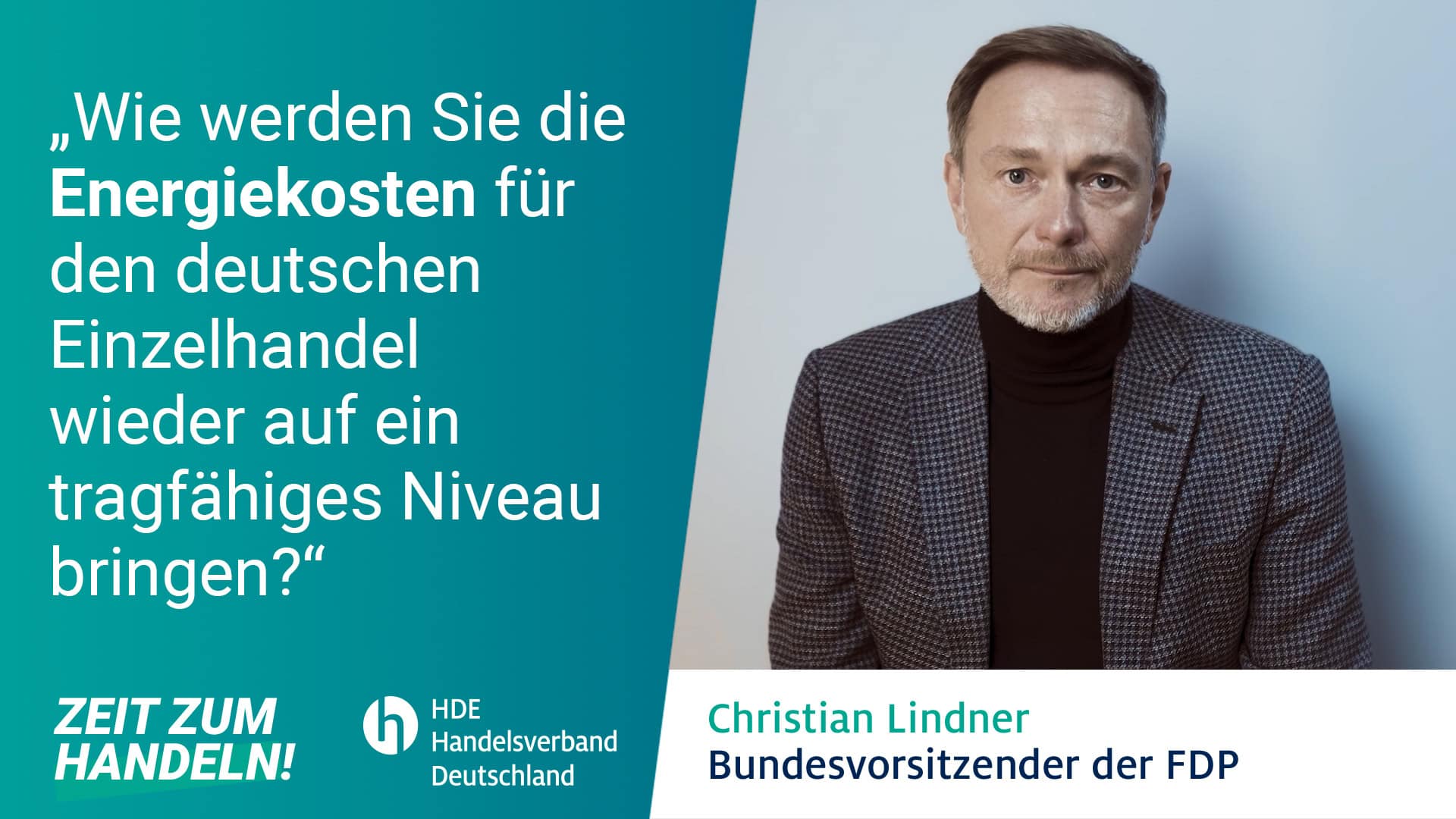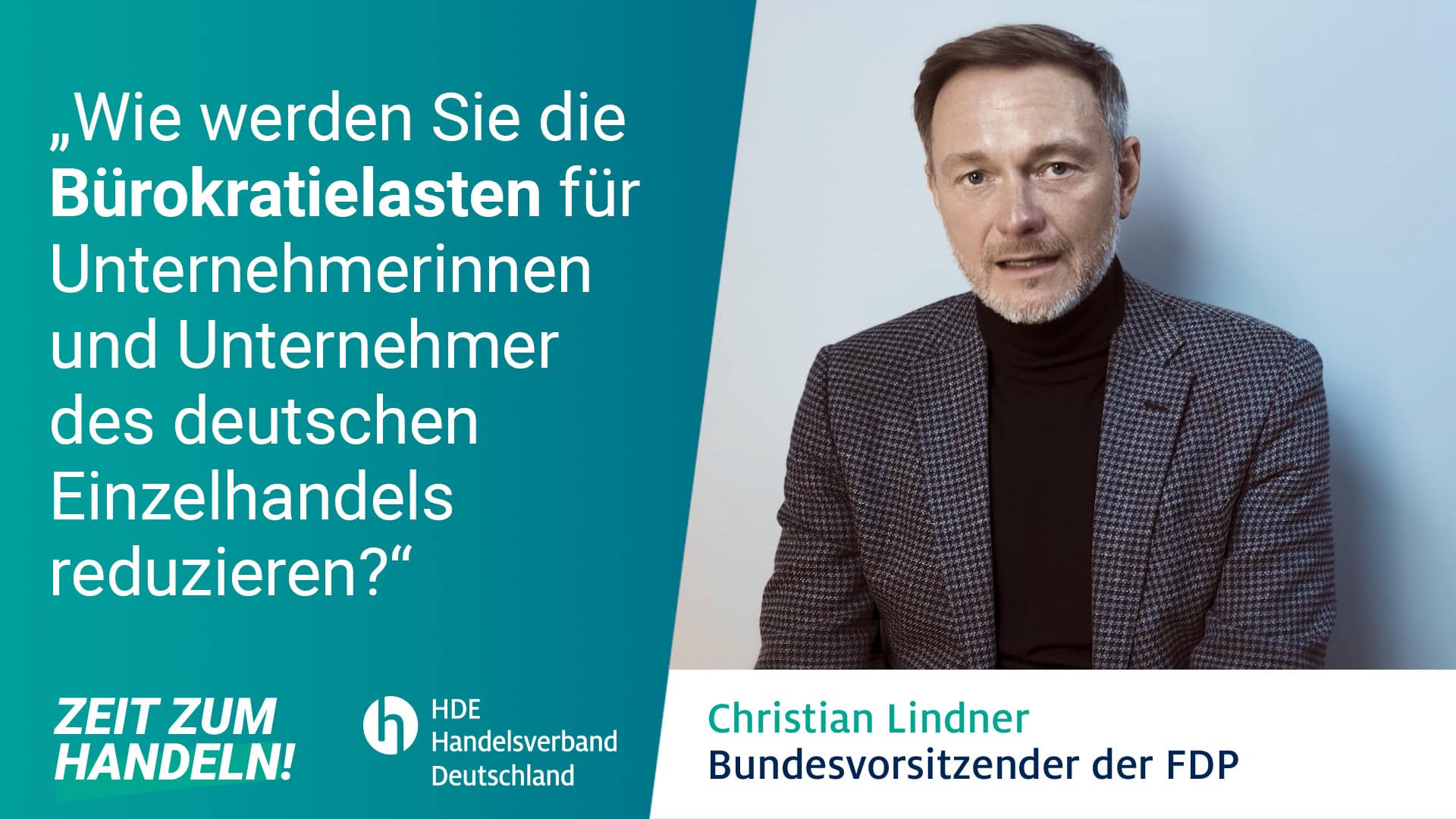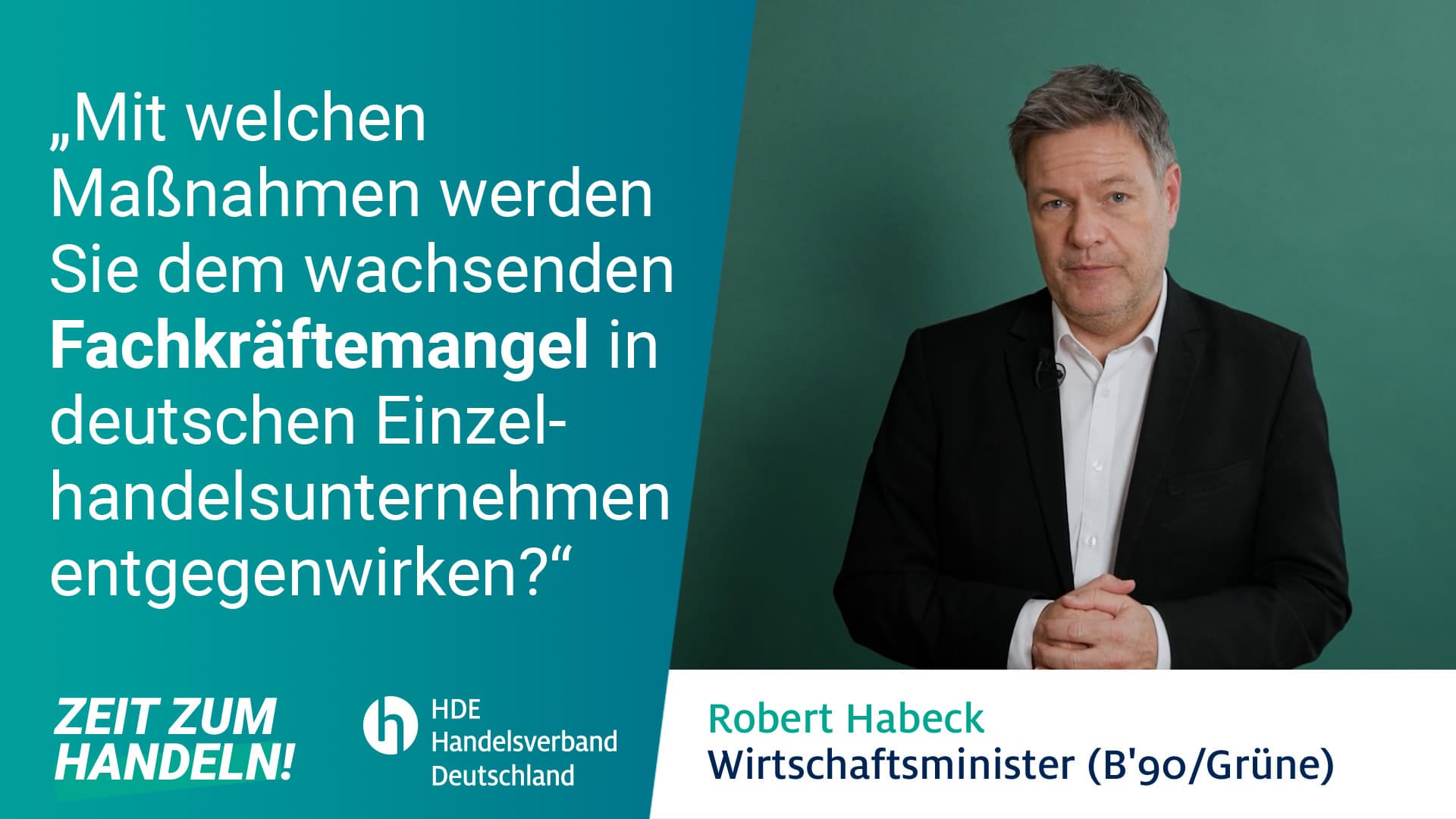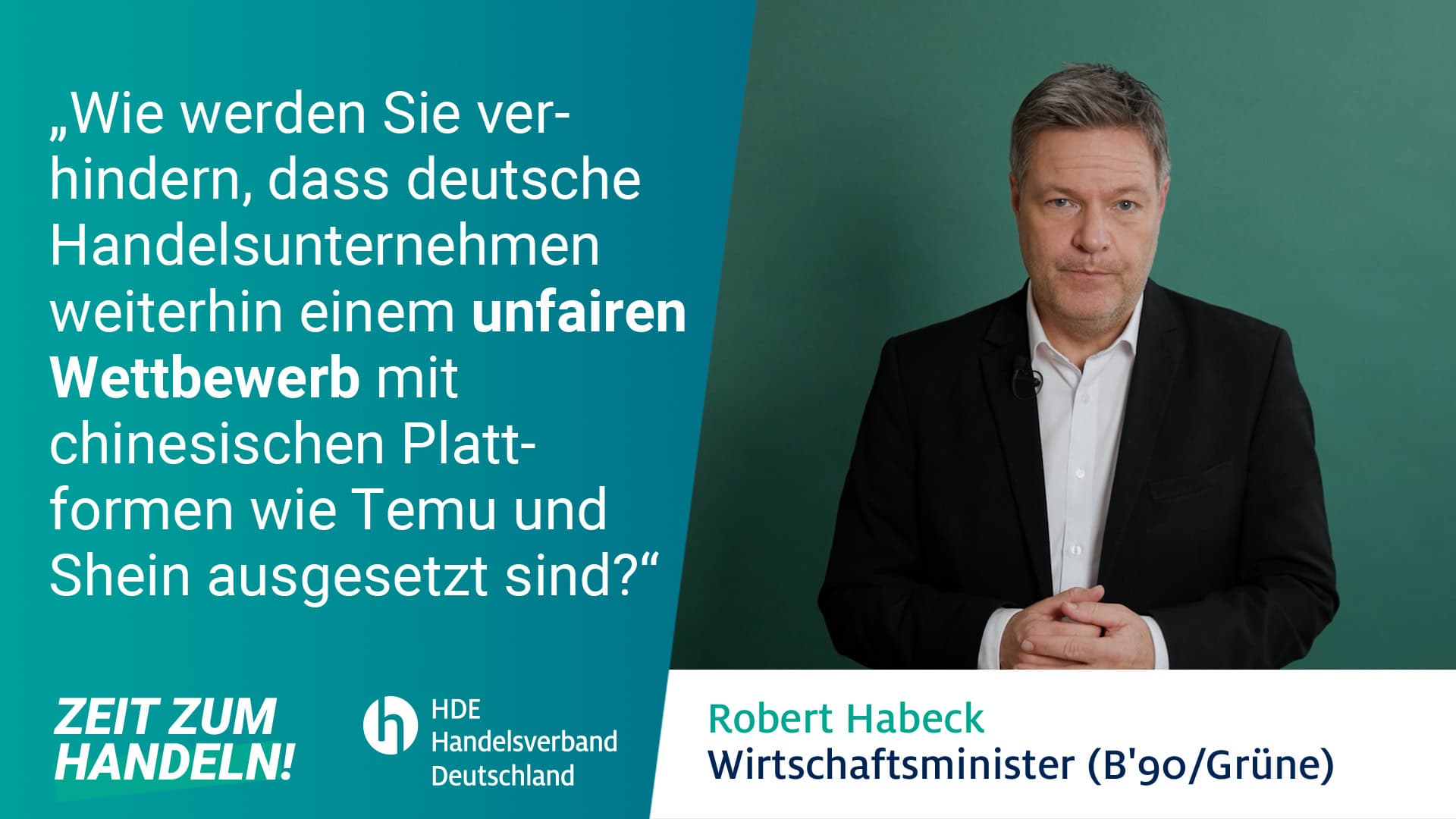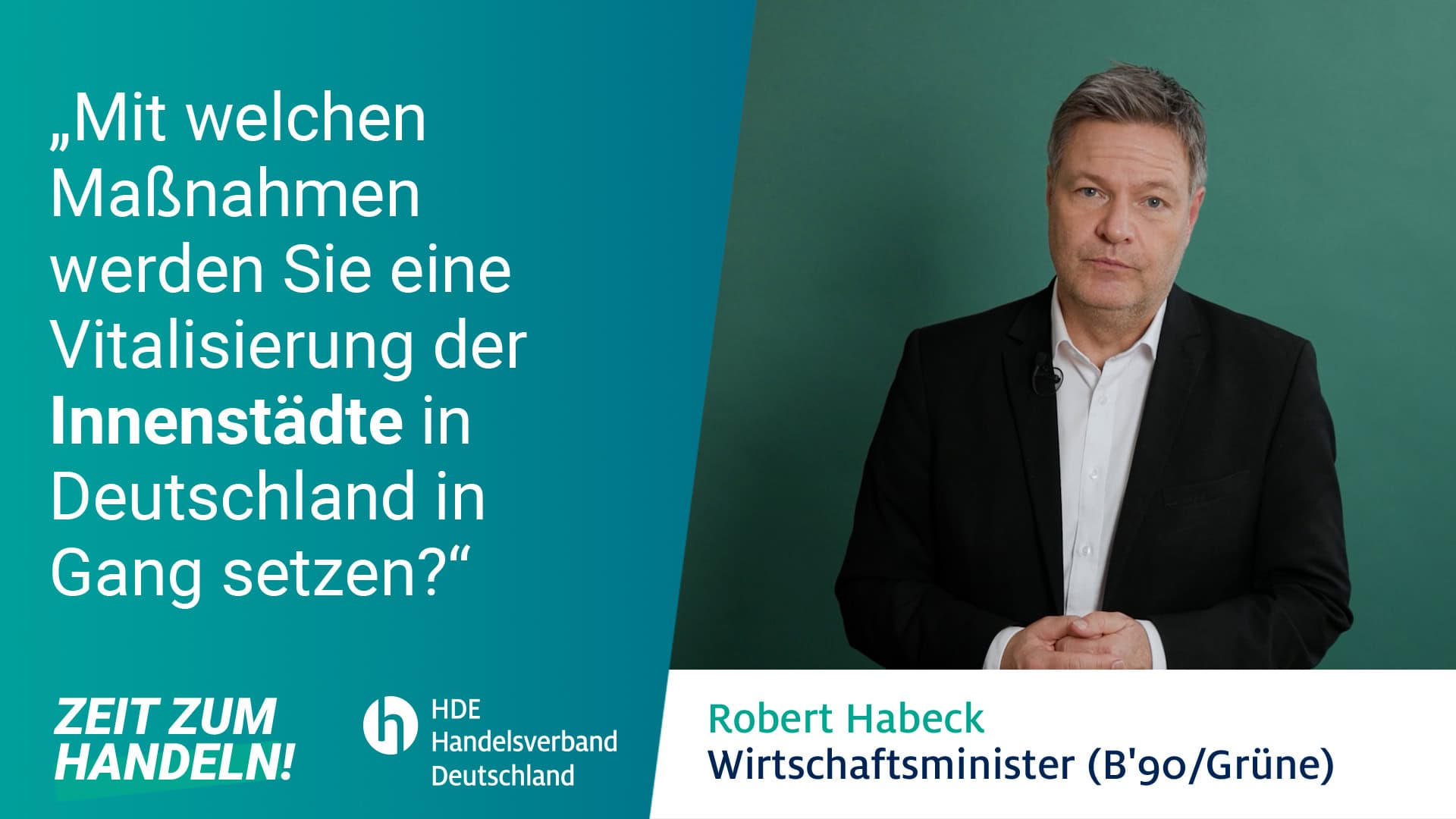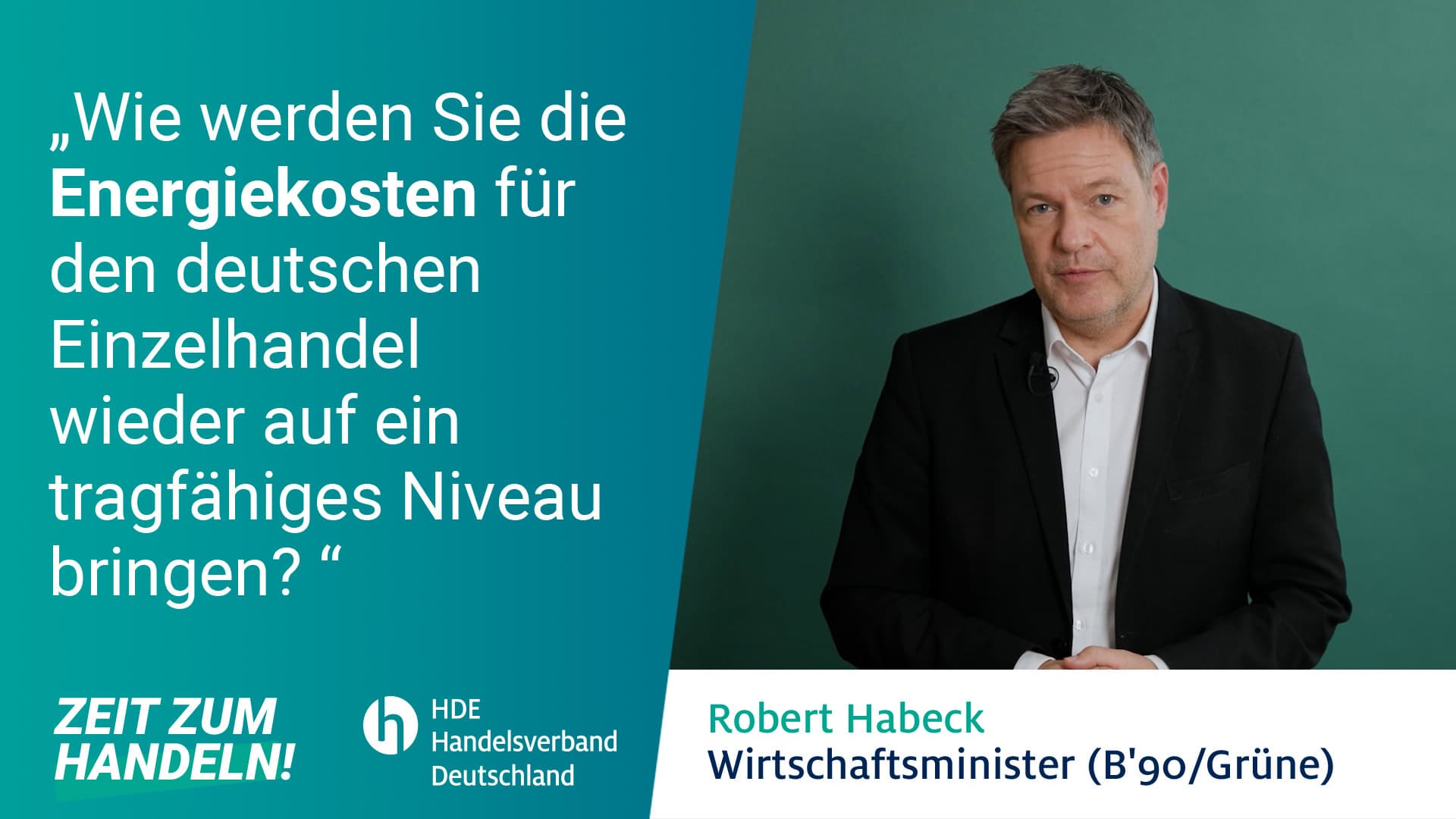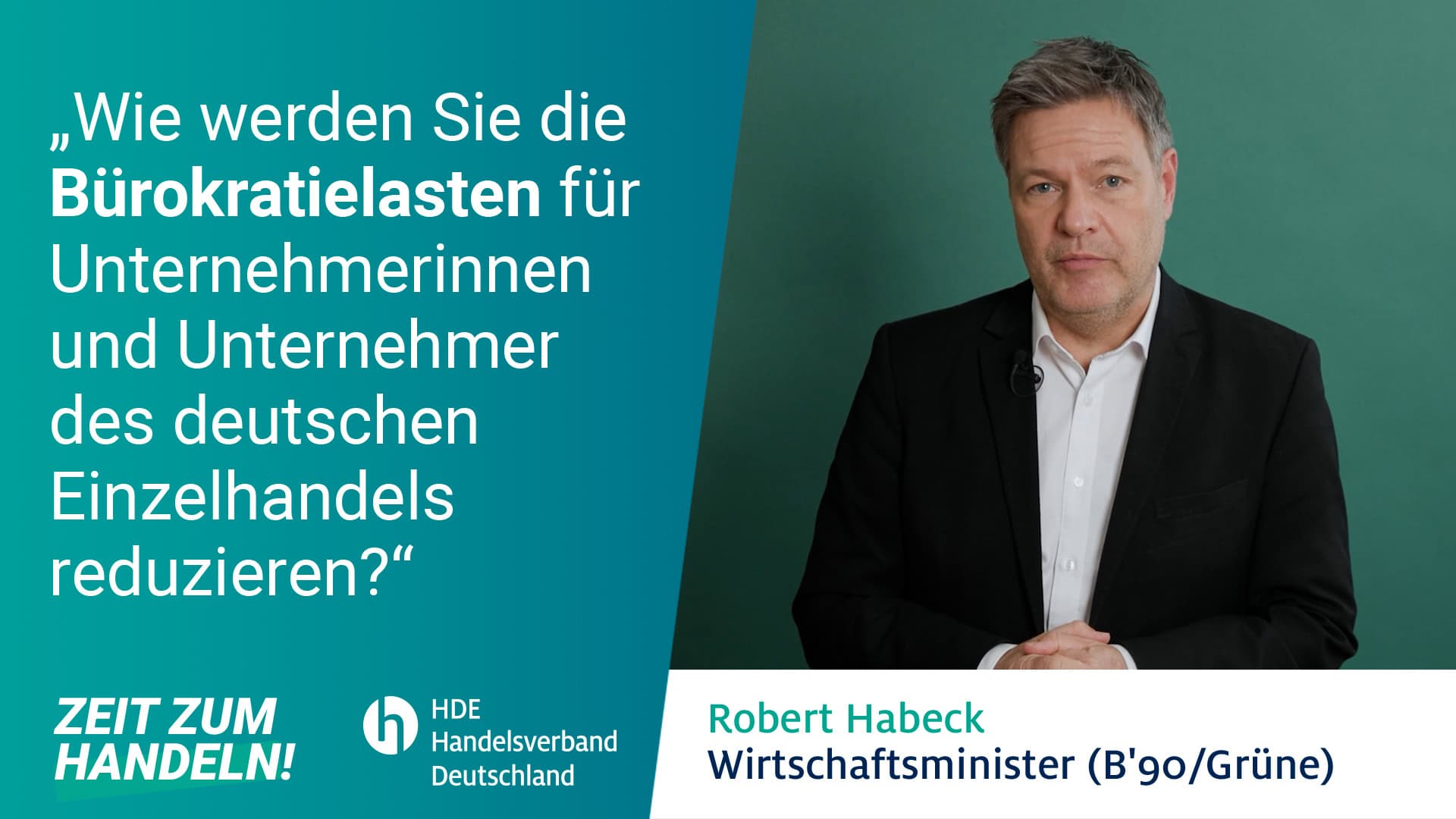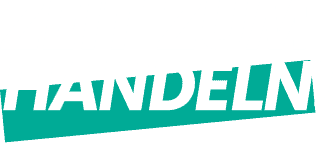So sieht es aus
Die nationale Umsetzung der EU-Entgelttransparenz-Richtlinie
Im Juni 2023 ist die EU-Entgelttransparenz-RL 2023/970 (EU-Richtlinie) „zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen“ in Kraft getreten. Die Bundesregierung hat im Sommer 2023 die Wirksamkeit des EntGTranspG mit Blick auf die Entwicklung von Entgeltunterschieden zwischen Frauen und Männern evaluiert. Danach lässt die bevorstehende Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie umfassende neue gesetzliche Vorgaben in Bezug auf das EntGTranspG erwarten. Das federführende Familienministerium (BMFSFJ) erarbeitete bis zum vorzeitigen Bruch der Ampelkoalition im November 2024 einen Referentenentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie, der dann aber letztlich nicht mehr in die Verbändeanhörung gegeben wurde. Es bleibt also zunächst weiter abzuwarten, wie eine neue Bundesregierung mit diesem Thema umgehen wird bzw. wie schnell und in welcher Form eine Anpassung des nationalen Recht vom Familienministerium angestrebt wird. Die Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht müsste spätestens bis Juni 2026 erfolgen und damit noch innerhalb der nächsten Legislaturperiode.
Die Herausforderung
Umsetzung der EU-Richtlinie mit Augenmaß
Die Richtlinie enthält mehrere kritische Maßnahmen und verlangt u. a. Angaben zum Entgelt bereits für Bewerber, einen umfassenden Auskunftsanspruch für Arbeitnehmer unabhängig von der Betriebsgröße, eine Prozessstandschaft zur Durchsetzung des individuellen Auskunftsanspruchs, regelmäßige Berichtspflichten über das geschlechterspezifische Entgeltgefälle für Arbeitgeber ab 100 Beschäftigten, jährliche Informationspflichten über das bestehende Auskunftsrecht sowie einen Schadensersatz- bzw. Anspruch auf Entschädigung ohne eine vorab festgelegte Obergrenze sowie Sanktionsregelungen.
Zeit zum Handeln
Schweren Eingriff in die Tarifautonomie verhindern
Die umfassenden neuen Vorgaben der Richtlinie gehen teilweise deutlich über die aktuell geltenden Gesetzesvorgaben im EntgTranspG hinaus. Daher muss die Anpassung ins deutsche Recht mit Augenmaß erfolgen. Dazu zählt auch, die Umsetzungsfristen bis Juni 2026 voll auszuschöpfen und sinnvolle Unterstützungsleistungen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, auf den Weg zu bringen. Das EntgTranspG verbietet bereits seit 2017 ausdrücklich bei gleicher und gleichwertiger Arbeit eine unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung des Geschlechts im Hinblick auf sämtliche Entgeltbestandteile und Entgeltbedingungen. Es enthält zudem einen individuellen Auskunftsanspruch für Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten und eine Beweislastumkehr zulasten der Arbeitgeber. Der in der Richtlinie angelegte individuelle Auskunftsanspruch zur durchschnittlichen Entgelthöhe vergleichbarer Arbeitnehmer ist als grob mittelstandsfeindlich und hoch bürokratisch abzulehnen, da er nicht an einen Schwellenwert gebunden wäre. Auch die in der EU-Richtlinie vorgesehene Berichterstattungspflicht über das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle für größere Unternehmen wäre mit enormem Bürokratieaufwand verbunden. Bei den Berichtspflichten wird eine 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie gefordert, darüber hinausgehende nationale Berichtspflichten sind strikt zu unterlassen. Hinzu kommt, dass eine Änderung ganzer Entgeltsysteme ein hochkomplexer Prozess ist. Für tarifgebundene und tarifanwendende Unternehmen muss es weiterhin Erleichterungen geben, etwa in Form vereinfachter Verfahren und längerer Fristen. Zumindest aber muss der Verweis auf einen angewendeten Tarifvertrag zur Erfüllung des Auskunftsanspruchs ausreichen. Tarifverträge bieten ein transparentes, geschlechtsneutrales und an objektiven Kriterien ausgerichtetes Vergütungssystem. Für Tarifverträge gilt deshalb auch eine Richtigkeitsgewähr. Insbesondere die Einführung eines verpflichtenden Prüfverfahrens würde einen schwerwiegenden Eingriff in die Tarifautonomie (Art. 9 Abs. 3 GG) darstellen. Die Tarifbindung ist branchenübergreifend in Deutschland rückläufig und würde ohne diese Erleichterung weiter stark unter Druck geraten. Die EU-Richtlinie adressiert nicht die tatsächlichen Ursachen für die unterschiedliche Bezahlung. Der HDE fordert eine gezielte Verbesserung von Erwerbs- und Karriereaussichten durch die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für den Einzelhandel wäre es von besonderer Bedeutung, wenn bundesweit flächendeckend an allen Werktagen (Mo – Sa) auch nach 17 Uhr eine Kita-Betreuung selbstverständlich möglich wäre.
Steven Haarke
Geschäftsführer Arbeit, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik
E-Mail: haarke@hde.de